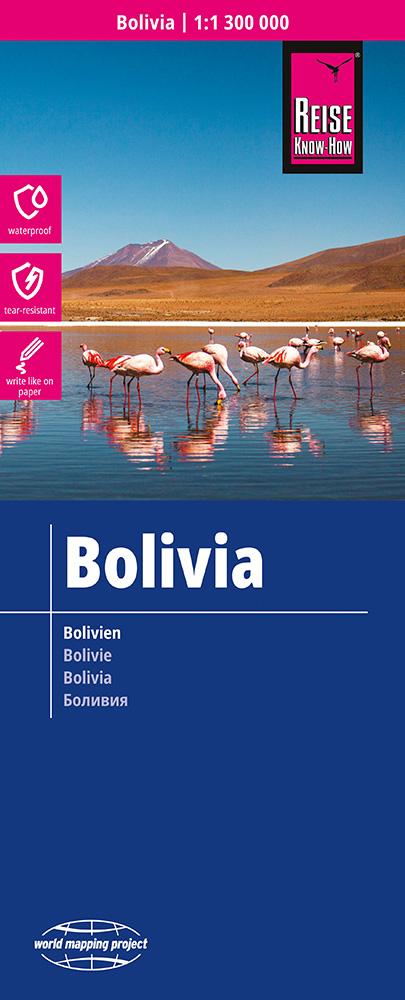Claudia & Daniel unterwegs in Bolivien & Nordargentinien

26. September – 30. Oktober 2018 | 990 km, 9.890 hm
Jetzt trifft es auch die Reichen. In La Paz, dem Sitz der Regierung, fehlt das Wasser. Selbst im Villenviertel kommt 2016 kaum ein Tropfen aus dem Hahn. Bolivianer errichten Straßenblockaden, entführen gar Politiker, Geiselnahmen im Kampf um das Kostbarste der Welt. Bolivien hängt am Tropf der rasant schmelzenden Andengletscher und zählt zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern weltweit. Sein sozialistischer Präsident Evo Morales wirft dem Westen eine „historische Klimaschuld gegenüber dem Planeten“ vor, fordert die Abkehr von kapitalistischer Weltwirtschaft und ein internationales Schiedsgericht, das über die Einhaltung der Klimaziele aller Länder wacht. Gleichzeitig weicht der Regenwald den Sojaanbauflächen in seinem Land. An den Salzseen des bolivianischen Hochlands wurde Lithium entdeckt, die größten Vorkommen weltweit. Bolivianer und Chinesen verbrauchen und verseuchen das letzte bisschen Wasser für jenen Stoff, ohne den die Menschheit keine Smartphones hätte.


Bei unserer ersten Reise 2014 empfanden wir die Bolivianer eher als distanziert denn hilfsbereit. Noch immer lassen sich die Marktweiber ungern fotografieren, die Kamera sauge ihnen „die Seele aus dem Körper.“ So der Aberglaube. Doch plaudern wir häufiger miteinander, werden mit Wasser, Benzin für den Kocher und stets einem fröhlichen Winken aus dem Autofenster beschenkt. Vielleicht nehmen wir jedes Fünkchen Freundlichkeit auf den Rädern intensiver wahr, vielleicht waren unsere Ansprüche als in Watte gepackte Hoteltouristen und kindisch fordernde Reiseanfänger damals zu hoch. Vermutlich ist es beides.


Fast haben wir Argentinien erreicht. Noch schnell die letzten Insidertipps des Reiseführers pauken, der Autor weiß: „Ein BH ist Pflicht für Frauen in Argentinien, ebenso wie haarfreie Achselhöhlen und Beine.“ Auch solle die Touristin „derbe sexuelle Anmachen“ schlicht „ignorieren“. So so. Die Brüste hochgeschnallt, ganzkörpergewachst und jeglichen weiblichen Selbstbewusstseins entledigt, passiere ich mit Daniel die argentinische Grenze …

Die Argentinier sind hinterm Steuer gespaltene Persönlichkeiten: bei freier Bahn bejubeln sie uns wie Messi und Maradona, geht es jedoch enger zu, werden wir messerscharf geschnitten. Nach anderthalb Jahren unfallfreier Fahrt wollen wir das Glück nicht irrsinnig kitzeln und weichen auf Nebenrouten aus, die alles sind – außer asphaltiert. Dafür um Welten sicherer und hundertmal schöner als die wenigen geteerten Hauptstraßen.


In Purmamarca packen wir die Essenstasche voll, wieder blicken wir zwei Wochen steiler Passstraßen und Abgeschiedenheit entgegen. Mariella backt noch schnell Empanadas für uns und beschwert sich über die immer heftiger brennende Sonne: „Selbst ich Indigene trage jetzt Sonnencreme auf.“ Ein Satz, den wir in den kommenden Wochen häufiger hören werden.

Beladen mit Essen und 10 Litern Wasser packen wir an einem Tag 2000 m Anstieg, selbst stürmischem Gegenwind zum Trotz. Unser Blut muss von der Überquerung des Altiplano immer noch dick sein wie Erdbeersirup, die Beine Protein gewordener Stahl. Euphorie und das Gefühl, verdammt stark zu sein, halten allerdings nicht lange an. Werden rücksichtslos verdrängt von Verzweiflung, Wut, ja purem Hass.



"Die bekloppteste Piste der Welt“, das wäre mal ein Weltkulturerbe der Unesco! Den Preis gewinnt die „Straße“ entlang der Salinas Grandes. Knöcheltiefer Schotter, Sand, fußballgroße Felsen und ein Wellblech, dass die Bandscheiben aus den Fächern springen. Auf gerader Ebene rattern wir mit fünf Kilometer in einer Stunde, knapp hundert liegen noch vor uns. Mit Karacho trete ich gegen die Radtaschen, will meine Wut herauspfeffern. Daniel verflucht – wortwörtlich zähneknirschend – die sandbeladenen Gegenwinde. Völlig entnervt beschließen wir, die Andenrunde abzubrechen.
Just in diesem Moment hält ein Kleinbus und heraus purzeln lauter Sympathikusse. Nicht, dass wir die schweizer und deutschen Touristen persönlich kennen würden – doch jeder hält eine andere prickelnde Gabe in der Hand: der erste eine Gallone Wasser, die zweite Cola, die dritte Chips und der vierte eisgekühltes Bier – Halleluja! Als wir uns abends im Zelt zuprosten, fällt die Entscheidung leicht: die geplante Runde ziehen wir durch!

Vor uns liegt der höchste Pass Argentiniens, gar einer der höchsten weltweit: Abra del Acay. Gleich einer endlosen Spaghetti windet sich die Straße stetig bergan. Eigentlich wären wir ganz fix oben mit der Fitness unseres Lebens, doch holt mich die erste Erkältung seit über einem Jahr endgültig ein. Mit verstopfter Nase, Angina und high von Schmerzmitteln keuche ich hinter Daniel hinauf. Zähle Pedaltritte, um mich zu fokussieren, mache pedantisch alle 500 m eine kurze Verschnaufpause und sage mir immerfort, dass ich bessere Zeiten erst durch schlechtere verdienen muss. Psychospiele mit Erfolg. Nach vier Stunden erreichen wir den Pass, 4.995 m. Vor unseren Augen das Sinnbild der Menschheit: neben Marienfiguren liegen zerbrochene Bierflaschen, flattern Klopapierfahnen im Wind.


Am nächsten Morgen erwacht Daniel in moribunder Qual: Männergrippe. Mich plagt zur Erkältung nun noch eine Gürtelrose, ein Ruhetag muss her. Hotelengel Pepe hat ein Herz für Rotznasen, gibt uns das Zimmer zum halben Preis. Er wäre heute nicht hier, hätte sein Vater nicht das schlimmste Erdbeben der Umgebung überlebt. 1930 feierten die Dorfbewohner am Heiligen Abend das gute Erntejahr, einen Wimperschlag später waren nur noch eine Handvoll von ihnen am Leben. Darunter der Vater. Angst vor dem nächsten Desaster hat Pepe dennoch nicht: „Ich will doch das Leben genießen. Angst macht unfrei!”

Gelassen sieht auch Bauer Milagro der tektonischen Gefahr entgegen. Wovor er denn sonst Angst habe, wenn nicht vor dieser permanenten Bedrohung? Ohne Zögern antwortet er: „Vor dem Wassermangel.“ Der Alltagsheld zieht vier Kinder groß, pflegt seine Eltern, doch ob der Fluss noch bis an sein Lebensende Wasser führen wird? „Veremos.“ Mal sehen … Andere Ländereien habe er keine. Mariella, Milagro, selbst die zahnloseste Alte weiß um den „cambio del clima“, hier wie in Chile und Bolivien sowieso. „La contaminación“, Fabriken und Plastikmüll seien daran schuld, doch keiner zeigt auf uns, die Hauptverursacher.

Wasser, Nahrung, Öl, Holz, Bodenschätze. Ein Gefühl verfolgt mich auf dieser Reise mehr als jemals zuvor. Die fiese Gewissheit, mit meinen Konsum anderen Menschen etwas wegzunehmen. Nicht geldbringende Touristin, sondern Diebin, Gaunerin zu sein. Jede heiße Dusche löst neben enormer Befreiung inzwischen Gewissensbisse aus, jeder Plastikbeutel, der mir aus den Händen fliegt, panisches Hinterherrennen. Avocados haben wir ganz gestrichen, weil ein Kilo mehrere hundert Liter Wasser im Anbau verschlingt, den Menschen hier raubt.


Allein der Flug nach Santiago blies knapp drei Tonnen Kohlendioxid in die Luft, das entspricht fast der Hälfte unseres gesamten Jahresverbrauchs. Schon dieser Flug macht tausende „grüne“ Radkilometer zunichte. Doch was ist die Lösung? Uns das Fliegen verbieten, die Anzahl der Stempel im Reisepass limitieren? Andreas Altmann, der weltenbeste Reisereporter, schreibt: „Nur ein Einziges entscheidet über den Wert einer Reise und den Sinn des Fortgehens: die mitgenommene Neugier, der Wissensdurst, die Freude am Entdecken, der Hunger nach allem.“ Neugier meint nicht Sonne tanken, Yoga, bummeln, essen, shoppen, „mal raus kommen“. Neugier bedeutet all das zur Not links liegen zu lassen, um Land und Leute auszukundschaften. Legte man den Maßstab der Neugier zugrunde, würde das vermutlich schon die Hälfte aller touristischen Flüge einsparen.

Staunend verrenken wir die Hälse, bis der Nacken schmerzt: 12 Meter hoch ragen die Kandelaberkakteen des Parque Nacional de Los Cardones in den Abendhimmel. Stark wie Bäume, mehrere Tonnen schwer und mit fürchterlich langen Dornen. Es fällt schwer, einen Lagerplatz zwischen all den stacheligen Gewächsen zu ergattern, und natürlich handeln wir uns zerstochene Reifen und Isomatten ein.

Nach sieben Wochen in extremer Trockenheit und Höhe können wir keinen Wind, keinen Sand, keine Kälte mehr ertragen. Eine lange Abfahrt führt endlich zurück ins Paradies: dicke, warme, feuchte Luft, Bäume, ja richtige Wälder, BASF-Felder, selbst Bananenstauden und Palmen schmücken die Gegend um Salta.


Daniel wünscht sich Gehacktes, ich als Vegetarierin wage mich zum Fleischer, ziehe eine Nummer wie auf dem Bürgeramt und setze mich auf die Wartestühle inmitten des Supermarktes. Denn der Gang zum Metzger, dem wichtigsten Verkäufer des Landes, ist kein bloßer Akt, sondern hingebungsvolle Prozedur, die Vorbereitung zum wichtigsten Mahl der Woche: dem Asado, Rindersteaks auf dem Holzkohlegrill. Vor lauter dummen Fragen entschuldige ich mich beim Verkäufer, ich sei Vegetarierin. „Ich auch.“, erwidert Nicolas. Und ich zweifele an meinem Spanisch. Der Fleischer selbst ein Vegetarier – wie um alles in der Welt konnte das passieren? Nicolas erzählt die Geschichte vieler junger Argentinier. Als Informatiker finde er im krisengebeutelten Land keine Arbeit, habe jeden Job genommen, der ihm geboten wurde. Heute ist er also Fleischer.

„Man muss flexibel bleiben“, lächelt unser Zimmervermieter José verschmitzt, die ständigen Wirtschaftskrisen forderten permanente Anpassung, kein Beruf sei sicher. Er selbst verkauft Autos, seit längerem jedoch nur schleppend. Deswegen sattelt er jetzt um auf nackte Haut: „Ich eröffne bald zwei Dessousläden und einen Pornoshop, das geht immer. Aber wichtig ist, dass wir das Zeug auch online anbieten, hier im katholischen Argentinien traut sich nicht jeder persönlich in den Laden.“ Die Wirtschaftskrisen Argentiniens sind ein Kapitel für sich – doch wer die Schuld daran trage, da antworten alle mit den exakt gleichen Worten. „¡Porque los politicos nos roban todos!“ Die Politiker bestehlen uns alle! Was José dann von der Wahlpflicht in seinem Land halte? „Gäbe es keine Pflicht zum Wählen, würde es keiner mehr tun.“

Systemkonform wollen wir am nächsten Tag die Busfahrer bestechen, um mitsamt den Rädern ins weit entfernte Mendoza zu gelangen. Schon am Eingang zum Bahnhof wetzt uns ein pummeliger Zwerg entgegen, in zerfledderten Jeans, mit schwarzen Fingernägeln. Pepe meint – augenzwinkernd – die Räder müssten per Post versandt werden, zufällig arbeite er dort, werde die guten Stücke in Kartons packen und die Busfahrer zur Mitnahme überreden. Wir wittern einen Trick, kaufen die Tickets und wollen die Steuermänner lieber selbst bestechen. Doch in diesem Land, in dem Polizisten, Ärzte, Politiker, Lehrer so selbstverständlich geschmiert werden wie die Jungfrau Maria heißt, erweisen sich ausgerechnet die Busfahrer als nicht käuflich. Nein, Räder seien im Gepäckraum verboten, da nütze auch kein Schmiergeld. Der Bus fährt ohne uns. Niedergeschmettert entschuldigen wir uns bei Pepe für unser Misstrauen, der Gute packt die Räder ein und regelt den Transport. Was haben wir den kleinen Mann unterschätzt, aus Scham verdoppeln wir sein Trinkgeld! Noch während wir auf die Abfahrt warten, spricht uns eine gut gekleidete Frau an, versucht uns mühsam ein Gespräch ans Bein zu nageln. Just in diesem Moment streunt ein Teenager um die Räder – die übliche Diebesmasche, eine lenkt ab, der andere stiehlt. Als die Frau erfolglos von dannen zieht, ist auch der Junge verschwunden.
Man halte also fest: einem kleinen Postboten in zerschlissener Kleidung kann man trauen, gut gekleideten Damen nicht. Polizisten besticht man, Busfahrer nicht. Verstehe einer die Spielregeln dieses Landes!
In Mendoza absolvierte Daniel 2010 einen Teil seines praktischen Jahres im öffentlichen Krankenhaus der Stadt. Verändert hat sich wenig. Schon damals bröckelte der Putz, pfiff der Wind durch die zerbrochenen Fenster. Erinnerungen an überfüllte Zimmer mit acht, zehn Patienten. Junge Kerle mit gebrochenen Beinen, die sich keine Operation leisten können und sieben Wochen auf der Streckbank liegen: einen Nagel durch die Ferse, daran ein Ziegelstein, so werden die Frakturen der Armen gerichtet. Morgens Tee mit trocken Brot, mittags auch, abends sowieso. Fast täglich werden Opfer der Bandenkriege eingeliefert, manchmal von Angehörigen in der Schubkarre angeschleppt, mit literweise Blut ausgekippt, auf’s Übelste zugerichtet und in diesem Krankenhaus sowieso schon tot. Es mangelt an Medikamenten, Papier, Kugelschreibern. Die Ärzte arbeiten morgens im öffentlichen Krankenhaus und nachmittags in den privaten, um überhaupt Geld zu verdienen. Und in Deutschland? Beschweren sich Patienten über’s Essen …

Die maroden Krankenhäuser sind nur ein oberflächliches Symptom der seit Jahrzehnten schwelenden Wirtschaftskrisen. Argentinien zählte zu den reichsten Ländern der Welt, exportierte während der Weltkriege Wolle und Fleisch ins zerstörte Europa. Fallende Weltmarktpreise, Misswirtschaft, Korruption und Sparmaßnahmen in allen sozialen Bereichen trieben das Land 2001 in die sogenannte „Tango-Krise“. Banken wurden geschlossen bis die Ersparnisse der Kunden keinen Wert mehr besaßen. Bis heute versickern Hilfsgelder in löchrigen Hosentaschen der Staatsbediensteten, fehlt ausländischen Investoren das Vertrauen, taumelt das Land von einer Krise in die nächste. Im reichen Nachwende-Deutschland geboren, konnte ich mir bis dato nicht wirklich vorstellen, wie es den Alltag verändert, wenn die Inflationsrate 30, oder gar 40 Prozent übersteigt, sich die Preise für Strom, Gas und Wasser innerhalb eines Jahres verfünffachen. Überall trübe Gesichter, kaum eine Spur südamerikanischer Leichtigkeit. Der argentinische Peso verlor die Hälfte seines Wertes, der Dollar kostet nun doppelt so viel, Kleidung, Elektronik, Lebensmittel, alle Importprodukte verteuerten sich in diesem Jahr quasi über Nacht. Kleiner Mann – was nun?

So wenig wie den Politikern und Richtern vertrauen die Argentinier ihrem eigenen Geld. Dollarscheine werden unter dem Kopfkissen versteckt oder das verdiente Geld gleich in Autos, Kühlschränke, Smartphones investiert – keiner bringt seine Ersparnisse zur Bank. Und das System ist umständlich: Viele bezahlen noch immer Miete, Strom- und Telefonrechnung in bar, einen halben Tag Arbeitszeit raubt das Schlangestehen. Obendrein lähmt die tägliche Siesta Menschen wie Wirtschaft. Zwischen zwei und sechs Uhr haben Apotheken, Geschäfte, Banken geschlossen, die Welt steht still. Nichts geht, alles schläft. Einmal explodiere ich, eine halbe Stunde an der (kaputten) Kasse wartend: „Señora, ich verliere Lebenszeit!“ Die Señora lacht nur.
Ein Teufelskreis der Lethargie und Korruption, in dem jeder jeden für die miserable Lage im Land verantwortlich macht und doch alle dazu beitragen. Ein Leben in permanenter Unsicherheit. „Ich bin müde von den vielen Krisen“, meint Eric, Daniels ehemaliger Zimmerkollege. Eigentlich studierte er Geschichte, heute hat er, wie viele seiner Altersgenossen, mehrere Jobs: ist Sommelier, vermietet Cabañas, tischlert. Bald wird er nach Chile gehen, auf einem Weingut sein Geld verdienen.

Die steigende Armut treibt viele in die Kriminalität. Ab zehn Uhr ziehen Banden durch ihre Viertel, nimmt man besser ein Taxi selbst für kurze Strecken. Daniels ehemalige Freundin Theresia arbeitet in Mendoza als Kindertherapeutin. Viele ihrer jungen Patienten seien verhaltensauffällig, weil die Eltern Drogen konsumierten oder im Gefängnis schmorten. Auch der Machismo, die Degradierung der Frau, potenziere die häusliche Gewalt.


Während wir uns unterhalten, schmettert ein Straßenmusiker Folklore. Plötzlich stimmt ein Passant mit ein, voller Inbrunst und Emotion, ohne Scham und Scheu. Auch das ist Argentinien, das offen Leidenschaftliche, das nach außen hin Gefühle zeigende. Keinem zwickt hier ein Stock im Hintern und alle lachen, wenn wir den deutschen Tanzklassiker schlechthin vorführen: den „Thekensteher.“